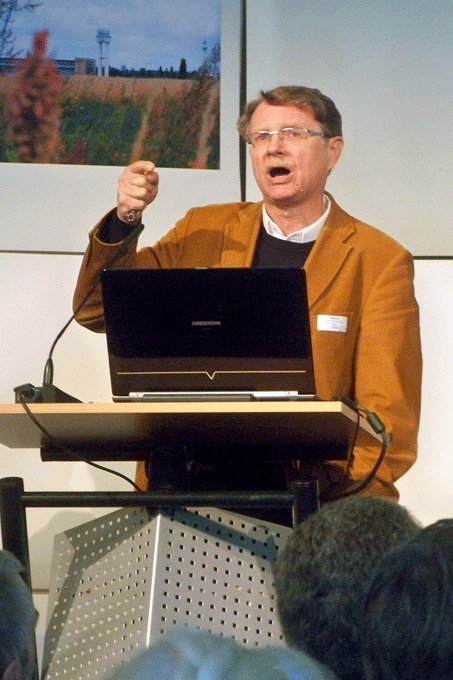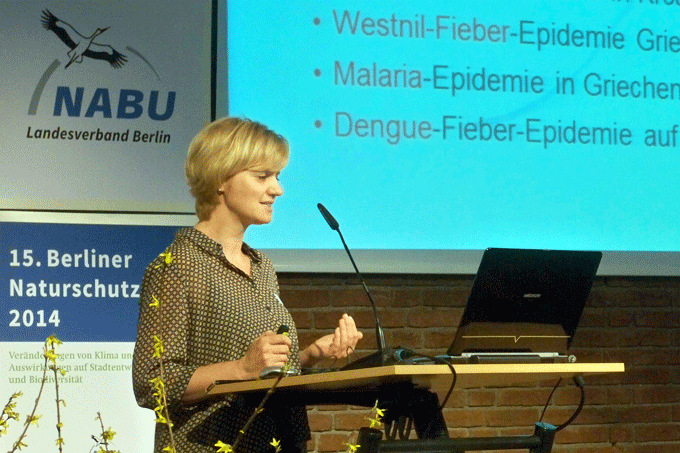Veränderungen von Klima und Landschaft
15. Berliner Naturschutztage 2014

Die Vorträge des 15. Naturschutztages zeigen deutlich: Der Klimawandel wirkt sich auf Mensch und Natur aus, Strategien müssen zwingend entwickelt werden.
Beim 15. Berliner Naturschutztag drehte sich alles um das Thema "Veränderungen von Klima und Landschaft - Auswirkungen auf die Stadtentwicklung und Biodiversität" und lockte am 22. Februar 2014 nicht nur namhafte Referenten in die Jerusalemkirche in Mitte, sondern auch rund 250 interessierte Besucher. Die Gastredner hatten facettenreiche Vorträge mit im Gepäck und ließen diesen Tag so zu einem Erfolg werden.
- Grußwort des Staatssekretärs Christian Gäbler
- Prof. Dr. Franz Bairlein: Klimawandel und Zugvögel
- Dr. Torsten Langgemach: Biodiversität und Energiewende
- Prof. Dr. Carlo W. Becker: Strategien für eine klimagerechte Stadtentwicklung
- Prof. Dr. Dieter Scherer: Klimawandel und Stadtklima - ein Rennen von Hase und Igel?
- Dr. Henning Schirmel: Natur- und Umweltschutz im Flächenmanagement der DB AG
- Dr. Doreen Werner: Klimawandel und Globalisierung - Auswirkungen in Deutschland an Hand der blutsaugenden Mücken
Kapitel: Programme und Pläne
Das Land Berlin ist nicht untätig. Staatssekretär Christian Gaebler machte in seinen Grußworten deutlich, dass sich die Politik der Veränderungs- prozesse durchaus bewusst ist, und stellte eindrucksvoll den umfangreichen Programm- katalog des Senats vor. Von der Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt über die Umsetzung des Biotopverbundes, die Stadtbaumkampagne, den Stadtentwicklungsplan Klima, die Aktualisierung der Roten Listen, die Charta zur kommunalen Klimaanpassung bis hin zu vielen weiteren Einzelmaßnahmen. Schließlich hat sich die Regierungskoalition das Ziel einer klimaneutralen Stadt für das Jahr 2050 vorgenommen.
Daher muss sich die Politik an ihren eigenen Zielen auch messen lassen. Gefragt ist also der konkrete Umsetzungswille des bisher rechtsunverbindlichen Programmkatalogs. Dies kritisierte Torsten Hauschild, 1. Vorsitzender des NABU Berlin, bei der Danksagung an den Staatssekretär. Aus der Sicht des NABU Berlin sind die einzelnen Ziele und Maßnahmen des Senats auch zu koordinieren und sollten nicht in einem Widerspruch oder schlimmsten Falls in Konkurrenz zueinander stehen. Wenn es um einfache Dinge, wie um ein naturschutz- fachliches und auf Klimafolgen abgestimmtes Pflegemanagement geht, werden zudem die Bezirke und Kommunen auf finanzieller Ebene oft allein gelassen, betonte Hauschild.
Kapitel: Vogelzug
Lebhaft und anschaulich brachte Prof. Dr. Franz Bairlein vom Institut für Vogelforschung die Auswirkungen der menschen- verursachten Klimaveränderungen für die Zugvogelwelt auf den Punkt. Bairlein, dessen Forschungsschwerpunkt der Vogelzug ist, zeigte in seiner Rede mittels anschaulicher Diagramme und Datensätze Veränderungen im Zug- und Brutverhalten oder in der Populationsdynamik auf: Demnach kehren Zugvögel im Frühjahr früher aus ihren Winterquartieren zurück und/oder ändern ihre Abzugszeiten im Herbst, wodurch sich teilweise die Aufenthaltszeiten im Brutgebiet verlängern. Durch die verfrühte Rückkehr aus dem Überwinterungsgebiet entstehe zudem eine Diskrepanz, ein sogenannter "Mismatch", zwischen Brut- bzw. Legebeginn und ausreichender Nahrung. So seien beispielsweise Insektenlarven schon viel früher verfügbar, da sie wesentlich stärker auf den Klimawandel reagieren als Vögel. „Das Futter ist grundsätzlich da, aber es ist halt zu früh da“, fasste es der Ornithologe zusammen. Dies kann gerade für Zugvögel vielfältige Konsequenzen haben, da sie während ihrer Wanderungen auf "verlässliche" Rastgebiete angewiesen sind.
Bisher wenig untersucht seien in diesem Zusammenhang die Folgen klimabedingter Veränderungen im Nahrungsangebot und bei der Nahrungsqualität. Diese können besonders Zugvögel betreffen, die häufig von speziellen Nahrungsbedingungen für erfolgreichen Zug und nachfolgendes Brüten abhängig sind. Prof. Dr. Bairlein erklärte: Durch den CO2- und Temperaturanstieg leide der Eiweiß- bzw. Energiegehalt, die Qualität der Nahrung nehme ab. Er erläuterte dies am Beispiel der muschelfressenden Austernfischer und Eiderenten am Wattenmeer, deren Bestände dramatisch zurückgehen: Obwohl diese Tiere einen vollen Magen haben, würden sie schlichtweg verhungern.
Prof. Dr. Franz Bairlein misst dem Lebensraumschutz insgesamt die höchste Priorität bei, um die Folgen des Klimawandels für die Zugvögel abzumildern. Der Klimawandel sei nicht per se Ursache für die massiven Veränderungsprozesse, denen Zugvögel ausgeliefert seien, er komme verstärkend hinzu, weshalb Populationen nur dann überleben können, wenn es ausreichende Rückzugsräume gibt: "Wir müssen aufpassen, dass wir den Klimawandel nicht für alles verantwortlich machen, dass wir nicht alles, was wir selber in der Landschaft anstellen, mit dem Klimawandel entschuldigen. [...] Das primäre Ziel muss bei aller Diskussion um die Effekte des Klimawandels immer sein, dass es Lebensräume heute und Lebensräume für die Zukunft braucht."
Kapitel: Biodiversität und Energiewende
Zum Klimawandel gehört auch die Diskussion über die Energiewende. Damit beginnt ein politisches Terrain, auf dem Kosten klein oder groß gerechnet werden und Umwelt- und Naturschutzaspekte oft unter den Tisch fallen. Dr. Torsten Langgemach von der Vogelwarte Buckow brachte die Auswirkungen der Energiewende für die Biodiversität Brandenburgs denkwürdig ins Spiel. "Die heimische Vogelwelt ist derzeit weniger durch den Klimawandel als durch die Maßnahmen gegen den Klimawandel gefährdet", brachte es der Referent in seinem Vortrag "Biodiversität und Energiewende – Konflikte am Beispiel der Vogelwelt" kurz und knapp auf den Punkt. Nach der Rücknahme der Stilllegungsprämien für die Landwirtschaft im Jahr 2007 hat sich der Bestand vieler Arten massiv reduziert, Biogasanlagen und Windkraftanlagen nahmen zu. Neben den Landschaftsveränderungen durch Windparks und ihre Auswirkungen für die Vogelwelt skizzierte Langgemach anhand statistischer Auswertungen Bestandsrückgänge durch den Raps- und Maisanbau, mit denen sich kaum eine Vogelart arrangieren kann.
In solchen Monokulturen gingen Siedlungsdichte, Bruterfolg und Nahrungsangebot – und damit die Biodiversität – sprichwörtlich in den Keller. Ähnlich problematisch würde es sich bei den Windkraftanlagen verhalten: "Individuenverluste durch Kollisionen, Lebensraumverlust durch Meidung der Windanlagen bzw. Windparks, Verbauung von Flugwegen" waren dabei nur einige seiner Beispiele. Zwar wirke es sich auf die einzelnen Arten unterschiedlich aus und müsse daher differenziert betrachtet werden. Jedoch seien vor allem Greifvögel die Leidtragenden: Sie würden 38 Prozent der insgesamt 1.923 Kollisionsopfer in einem Jahr ausmachen. Insbesondere die bedrohten Rotmilane hätten mit der Windenergie und den Landschaftsveränderungen stark zu kämpfen: Pro Jahr würden allein in Brandenburg rund 300 Rotmilane durch die Kollision mit Windkraftanlagen sterben.
Kapitel: Klimagerechte Stadtentwicklung
"Die Wetterextreme nehmen zu - mehr Starkregenereignisse, mehr Urban Heat und mehr Hitzestress in der Stadt. Und wir wissen, die dicht bebaute Stadt mit viel Beton und wenig Grün potenziert die Effekte." - Wie es gelingen kann, Klimaschutz von einem Kostenfaktor in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln und die dichte Stadt fit für den Klimawandel zu machen, brachte Prof. Dr. Carlo Becker von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus in seinem Beitrag "Strategien für eine klimagerechte Stadt- entwicklung" auf den Punkt.
Er nannte hierfür sechs prägnante Strategien:
- 1. Begrünen: "Mehr Grün kühlt die Stadt, über Grün wird Wasser verdunstet und damit Energie verbraucht, Grün dämpft klimatische Extreme." Flächenpotenziale wie Dächer, Fassaden und Höfe sollen aktiviert werden.
- 2. Kühlen: "Stadt und Region müssen als 'Schwamm' entwickelt werden. Ein Schwamm kann Wasser aufnehmen, wenn viel da ist und es wieder abgeben, wenn es benötigt wird." Becker fordert daher einen Perspektivwechsel in der Wasserwirtschaft und mehr feuchte Flächen.
- 3. Verschatten: Schatten verringert Urban Heat, vielfältige Strategien im Bereich Städtebau, Fassadengestaltung und vegetative Verschattung durch Bäume seien möglich.
- 4. Rückstrahlen: Einfach und kostengünstig - "Helle Gebäude heizen sich nicht so stark auf und geben in der Nacht weniger Wärme an das Umfeld ab."
- 5. Wohlfühlen: Grüne Wohlfühloasen im Freien steigern das Wohlempfinden. Für das Klima seien zehn kleinere Parkanlagen mit einer Größe von ca. zwei Hektarn wirksamer als eine von 20 Hektar.
- 6. Multicodieren: "Städtische Nutzungen müssen mehrdimensionaler werden. Die einseitige, nur einen Aspekt berücksichtigende Nutzung der Stadt - Verkehr, Wohnen, Arbeiten, Grün, Naturschutz, Freizeit - muss in Zeiten des Klimawandel beendet werden."
Kapitel: Stadtklima
Sollten Städte nicht rechtzeitig auf den Temperatur- anstieg und die Extremereignisse reagieren können, sei das "Rennen von Hase und Igel" schon besiegelt. "Klimawandel und Stadtklima" hieß der thematisch eng angebundene Nachfolgevortrag von Prof. Dr. Dieter Scherer von der Technischen Universität Berlin, der die Gedanken seines Vorredners aufnahm und ergänzte.
Die insbesondere von größeren Städten verursachten Veränderungen des regionalen Klimas bewirken laut Scherer unter anderem eine deutliche Erhöhung der bodennahen Lufttemperatur. Eine Erhöhung von Hitzestressrisiken sei unter anderem die Folge, Maßnahmen sollten folgen: "Eine in Kürze in der Fachzeitschrift 'DIE ERDE' erscheinende Veröffentlichung belegt, dass in Berlin in den Jahren 2001 bis 2010 im Zusammenhang mit Hitzestress im Durchschnitt 1600 Personen pro Jahr starben, was ungefähr fünf Prozent aller Todesfälle ausmacht. Damit ist das mit Hitzestress einhergehende Sterblichkeitsrisiko in Berlin ca. 25-fach höher als das Risiko, an den Folgen eines Verkehrsunfalls zu sterben."
Kapitel: Natur- und Umweltschutz
Das Nachmittagsprogramm war verstärkt den Tieren gewidmet, die Klima- und Landschafts- veränderungen besonders ausgesetzt sind. Beginnend mit dem Vortrag "Natur- und Umweltschutz im Flächenmanagement der DB AG" von Dr. Henning Schirmel, Fachreferent von DB-Immobilien, der in seinem Beitrag darzulegen versuchte, welches Potenzial stillgelegte Bahntrassen und Flächen für das Stadtklima und die Arterhaltung haben können. So möchte die Deutsche Bahn AG zukünftig die Bereitstellung von nicht betriebsnotwendigen Flächen für Photovoltaik, Biomasseproduktion, Freizeit und Erholung sowie für A&E-Maßnahmen (Kompensation) inklusive Entsiegelung weiter in den Fokus stellen.
Beispielhaft stellte Dr. Henning Schirmel eine A&E-Maßnahme in Berlin vor: Im Rahmen des Bauvorhabens der Schienenanbindung Ost an den Flughafen BBI seien hier Artenschutzmaßnahmen durchgeführt worden. In unmittelbarer Nähe wurden laut Schirmel Kompensationsflächen bereitgestellt, welche für „Maßnahmen zur Schaffung von Lebensräumen für Reptilien auf einem mit Büschen, Hochstaudenfluren und kleinflächigen Trockenrasen bewachsenen Trassenstreifen“ genutzt wurden. Zudem seien Kastenreviere für Höhlenbrüter und Fledermäuse installiert worden.
Weiter ging es mit einem Artenporträt zum "Grünspecht - Vogel des Jahres 2014". Hierbei appellierte Dr. Klaus Witt von der NABU Berlin-Fachgruppe Ornithologie an die Zuhörer: Mit dem Kauf einer Flasche des NABU Berlin Apfelsaftes unterstütze man das lokale Klima, die Streuobstwiese und den Lebensraum von Grünspecht und Co. Diese Kaufempfehlung war jedoch nicht der einzige Aufruf an das Publikum.
Kapitel: Anpassungsstrategien
Der Naturschutztag endete mit der Aufforderung an die Teilnehmer, sich ehrenamtlich als „Mückenjäger“ zu engagieren. Dr. Doreen Werner vom Leibniz Zentrum für Agrarforschung stellte in ihrem Beitrag "Klimawandel und Globalisierung - Auswirkungen in Deutschland an Hand der blutsaugenden Mücken" das Projekt „Mückenatlas“ vor, das gleichzeitig das laufende Forschungsprogramm zum Stechmücken-Monitoring in Deutschland unterstützt. Engagierte Bürger helfen, wissenschaftlich verwertbare Daten zu erheben. Sie sammeln und verschicken Mücken, die von Spezialisten untersucht werden und zur Weiterentwicklung von Forschungsthemen beitragen, die in Deutschland wissenschaftlich lange vernachlässigt wurden.
"So fehlt es aktuell an grundlegendem Wissen über das Vorkommen und die Verbreitung der verschie- denen einheimischen Arten. Die zunehmende Globalisierung und Klimaveränderungen begünstigen die Einschleppung und Ansiedlung nicht-einheimischer Mückenarten", so Dr. Doreen Werner. Fragen wie: „Welche Stechmückenarten kommen aktuell in Deutschland vor?“, „Wie verteilen sich diese geografisch?“ und „Gibt es Veränderungen hinsichtlich ihres jahreszeitlichen Auftretens?“ seien besonders interessant. Das Fazit dieses Vortrags lautete folgerichtig: Der Klima- wandel in seiner globalen Ausprägung bringt nicht nur invasive blutsaugende Mücken nach Deutschland, er regt auch erfolgreich Citizen-Science-Projekte an. Dieser Zusammenhang sollte alle ehrenamtlich aktiven Naturschützer hoffnungsvoll stimmen - trotz aller klimatischen Veränderung.
14. Mai 2014