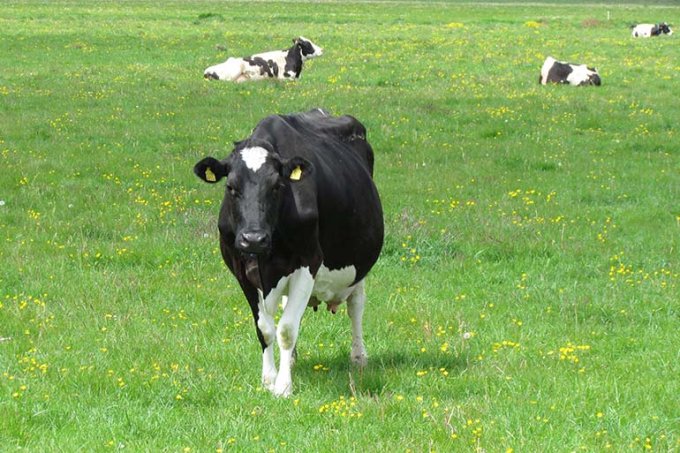1, 2, 3 – was sagt die Zahl auf dem Ei?
Tierschutz beginnt beim Einkauf

Eier aus Biohaltung – der Stempel verrät uns Haltungsform und Herkunft. - Foto: NABU/Sebastian Hennigs
Hühner als Eifabriken
Das Haushuhn stammt ursprünglich vom asiatischen Bankivahuhn ab, das höchstens 40 Eier im Jahr legt. Die heutige Agrarindustrie hat Hennen jedoch auf maximale Legeleistung hin gezüchtet. Sie produzieren rund 300 Eier pro Jahr. Diese kräftezehrende Leistung laugt die Tiere derart aus, dass sie nach 12 bis 15 Monaten ausrangiert und geschlachtet werden. In Hobbyhaltung hingegen haben Hennen eine Lebenserwartung von fünf bis sieben Jahren. Hähne können sogar zehn Jahre alt werden. Bis Ende 2021 wurden die männlichen Küken der Legerassen jedoch meist direkt nach dem Schlüpfen getötet. Da sie keine Eier legen und zu langsam Fleisch ansetzen, wurden sie standardmäßig geschreddert, vergast oder erfroren.
Seit dem 1. Januar 2022 dürfen Küken in Deutschland nicht mehr getötet werden. Sie werden dann entweder als so genannte „Bruderhähne“ aufgezogen oder durch Geschlechtsbestimmung aussortiert, bevor das Küken schlüpft. Doch diese Methode ist umstritten. Der Zeitpunkt der Geschlechtsbestimmung sei nach dem siebten Tag zu spät, sagen Tierschutzverbände. Denn Küken könnten dann bereits im Ei Schmerz empfinden. Ab Anfang 2024 sind daher nur noch Methoden erlaubt, die die Geschlechtsbestimmung bis zum siebten Tag ermöglichen. Ob bis dahin entsprechende Verfahren marktreif sind, ist allerdings unsicher.
Zu der extremen Legeleistung kommen in fast allen kommerziellen Haltungsformen Verhaltensstörungen der Tiere hinzu. Eng zusammengepfercht reißen die Hühner ihren Artgenossen die Federn aus oder bepicken Haut und Fleisch der anderen Tiere, was oft schwere Verletzungen zur Folge hat. Rot glänzende Objekte reizen zum Picken, weshalb offene Wunden und besonders die empfindlichen Kloaken – so nennt man den gemeinsamen Körperausgang des Huhns für Geschlechtsorgane, Harnleiter und Darm – angegriffen werden. Diese Attacken führen nicht selten zum Tod der verletzten Tiere. Als Gegenmaßnahme werden Hühner oft im Dämmerlicht gehalten. Das macht sie passiver, beeinträchtigt jedoch ihr Wohlbefinden und den Tag-Nacht-Rhythmus der Tiere.
Alternativen zum Hühnerei
Das beste Ei ist immer noch die Alternative dazu. Hier ein paar Anregungen, mit welchen Zutaten Sie das Ei in Ihren Gerichten ersetzen können:
- Reife Banane: Eine halbe Banane ist ein Ei. Gut für Kuchen, Muffins oder Kekse.
- Apfelmus: 75 Milliliter entsprechen einem Ei. Gut für Süßspeisen oder Teige.
- Essig und Natron: Ein Esslöffel Essig und zwei Teelöffel Natron ersetzen ein Ei. Gut für Lockerung bei Teigen und Broten.
- Kichererbsenwasser (Aquafaba): 100 Milliliter Kichererbsenwasser und ein halber Teelöffel Weinsteinpulver ersetzen Eiklar und werden wie dieses aufgeschlagen. Gut für alles, bei dem Eischnee benötigt wird.
Eier-Codes unter der Lupe
Seit 2005 müssen Eier mit dem Haltungssystem gekennzeichnet sein. Der Stempel auf dem Ei beginnt mit einer Ziffer für die Haltung, darauf folgt ein Länderkürzel und ein Zahlencode für Betrieb und Stall.
Die Haltungsform
0 – Biohaltung
In der Biohaltung verfügt jede Henne tagsüber über mindestens vier Quadratmeter Auslauffläche im Freien. Freigang muss den Tieren während eines Drittels ihrer Lebenszeit gestattet sein. Der Auslauf im Freiland sollte den Hühnern laut Vorgabe Deckung vor Feinden bieten und bewachsen sein, sonst nutzen ihn die Tiere aus Angst nicht. Im Stall muss ein Drittel der Bodenfläche fest sein und zusätzlich Einstreu enthalten. Draht- oder Spaltenboden sind dort nicht erlaubt. Außerdem sind für alle Tiere Sitzstangen vorgeschrieben. Maximal 16 Stunden am Tag darf das Licht brennen, und das Futter muss aus ökologischem Anbau stammen.

Immer mehr Biobetriebe ziehen männliche Küken groß, um sie als Fleischhähnchen zu vermarkten. - Foto: Helge May
Männliche Küken werden jedoch auch in Biobetrieben meistens getötet. Und in den Ställen sind sechs Hennen pro Quadratmeter und 3000 Tiere pro Stall erlaubt. In natürlicher Umgebung bilden Hühner Gruppen aus einem knappen Dutzend Tiere, in der eine klare Hackordnung für ein friedliches Miteinander sorgt. In Ställen mit einer so hohen Tierdichte hacken sie hingegen ungehemmt aufeinander ein. Ein großer Teil der vermarkteten Bioeier stammt aktuell aus solchen Großbetrieben.
Viele Biohöfe gehen allerdings mittlerweile über die EU-Mindestanforderungen hinaus und halten ihre Legehennen in kleineren Gruppen oder in mobilen Hühnerställen auf der Weide. Und immer mehr Biobetriebe, wie zum Beispiel die Höfe in der Bruderhahn-Initiative, ziehen außerdem die männlichen Küken groß, um sie als Fleischhähnchen zu vermarkten. Ein weiteres Projekt in der Biohaltung ist das „Zweinutzungshuhn“, das sich gleichermaßen als Eiproduzent und Fleischlieferant eignet. Weil die Tiere langsamer an Gewicht zulegen, dürfen sie zudem länger leben. Eier von solchen Betrieben sind wegen des höheren Aufwands natürlich auch teurer.
Wem das Wohl der Hennen und der männlichen Küken am Herzen liegt, sollte im Biomarkt also trotz des höheren Preises zu Eiern von Biohöfen greifen, die nicht nur die Mindeststandards einhalten, sondern erheblich mehr für ihre Hennen tun.
1 – Freilandhaltung
Freilandhaltung bedeutet, dass den Tieren ebenfalls vier Quadratmeter Auslauf im Freien zur Verfügung stehen. Das Futter soll überwiegend, aber muss nicht gänzlich aus ökologischem Anbau stammen. Im Stall drängen sich bis zu neun Hennen auf einem Quadratmeter. Die Gruppen umfassen bis zu 6000 Tiere, doppelt so viele wie bei der Biohaltung. Solche Bedingungen machen es den Hennen unmöglich, eine natürliche Hackordnung zu etablieren.
2 – Bodenhaltung
Zu über 60 Prozent kaufen die Deutschen, ebenso wie die meisten Lebensmittelhersteller, Eier aus Bodenhaltung. Diese findet meist in großen Hallen statt oder auch in Käfigen mit Etagen und Gitterböden. Sie werden Volieren genannt, obwohl die Hennen darin nicht fliegen können. Um die Kosten zu minimieren und die Staubemissionen zu senken, ist nur ein Drittel der Gesamtfläche mit Einstreu bedeckt. Der Rest der Fläche besteht aus Holz- oder Plastikgittern. Bei den Etagenvolieren ist sogar der gesamte Boden vergittert. Solche Böden verursachen häufig Verletzungen bei den Tieren.
Auch in Bodenhaltung dürfen neun Hennen pro Quadratmeter gehalten werden und Gruppen bis 6000 Tiere groß sein. Es gibt zwar Sitzstangen und Nester, doch einen Quadratmeter Nestfläche müssen sich bis zu 120 Tiere teilen. Das führt dazu, dass die Hennen unmittelbar nach dem Legen mit noch ausgestülpter Kloake aus dem Nest gedrängt werden – das Bepicken dieses Organs wird begünstigt.
Auch die Reizarmut, die extreme Tierdichte und die mit Ammoniak belastete, staubige Luft macht den Hennen sehr zu schaffen.
3 – Kleingruppen oder „Geflügelmast“
Kleingruppenhaltung ist eine Form der Käfighaltung. Allerdings wird sie nicht mehr so bezeichnet, nachdem im Jahr 2010 die Einzelkäfighaltung abgeschafft wurde. In den damaligen „Legebatterien“ vegetierten Hühner auf einer Fläche kleiner als ein DIN-A4-Blatt vor sich hin. Leider erlaubten Übergangsfristen nach dem Verbot noch jahrelange Ausnahmen.
An die Stelle der Legebatterien traten die bis heute genutzten „Kleingruppenkäfige“ mit 2,5 Quadratmetern Grundfläche und 40 bis 60 Tieren darin. Jedes Huhn hat somit 800 Quadratzentimeter Platz – ein DIN-A4-Blatt plus fünf EC-Karten!
Tierschützer*innen kritisieren den Begriff „Kleingruppe“ folgerichtig als Etikettenschwindel. Noch etwa acht Prozent der Legehennen werden auf diese Weise in Käfigen gehalten. Bis 2023 soll diese Haltungsform abgeschafft werden – in sogenannten Härtefällen bis spätestens 2028. Größte Abnehmerin von Eiern aus Geflügelmast ist die Gastronomie.
Der Ländercode
Nach der Haltungsklasse folgen zwei Buchstaben, die für den EU-Mitgliedstaat stehen, aus dem das Ei kommt – zum Beispiel steht NL für die Niederlande. Jedes zweite, in Deutschland konsumierte Ei stammt gar nicht von hier. Leider erkennt man die Herkunft der Eier nicht an der Verpackung, sondern nur am Stempel. Darauf können Sie bereits beim Einkauf achten.
Betrieb und Stall: Alles klar dank Code?
Die Information über Haltungsform und Länderherkunft soll Transparenz für Verbraucher*innen schaffen. Wer es jedoch noch genauer wissen will, scheitert oft bei der Frage nach dem Betrieb: Die auf den Ländercode folgende Nummer kennzeichnet zwar den Betrieb, diese Codes lassen sich aber in der Regel nicht zurückverfolgen. Lediglich ein Teil der Betriebe lässt sich über Seiten wie https://www.was-steht-auf-dem-ei.de zuordnen.
Der NABU empfiehlt:
- Wenn Sie die Gelegenheit haben, Eier von einem Biohof oder aus Hobbyhaltung zu kaufen, und sich sogar selbst vom Wohlergehen der Tiere überzeugen können, greifen Sie zu. Denn so gehen Sie ganz sicher, dass Ihr Eierkonsum nicht zu tierquälerischer Hühnerhaltung beiträgt. Wichtig: Fragen Sie ebenfalls, welche Hühnerrasse bei dem Biohof Ihres Vertrauens eingesetzt wird. Viele Biohöfe halten weiterhin die wegen ihrer braunen Eier beliebten Lohmann-Brown-Hennen. Diese Züchtung ist jedoch unter Tierschutzaspekten sehr umstritten.
- Greifen Sie im Laden bevorzugt zu Bio-Eiern von Initiativen wie „Bruderhahn“, die über die EU-Mindeststandards hinausgehen. In vielen Geschäften findet man mittlerweile Eier, die mit dem Logo „Ohne Kükentöten“ werben. Vermieden wird das Kükentöten entweder durch die Geschlechtsbestimmung im Ei oder durch die Aufzucht der Bruderhähne. Welches Verfahren jeweils angewendet wird, wird auf den Eierpackungen bislang jedoch nicht angegeben.
- Bedenken Sie, dass ein Großteil der erzeugten Eier in der Lebensmittelindustrie landet. Bei verarbeiteten Lebensmitteln müssen die Unternehmen die Haltungsform jedoch nicht angeben. Allein das EU-Biosiegel garantiert, dass in Fertigprodukten keine Eier aus Käfig- oder Bodenhaltung stecken.
Mehr zum Thema Eier und tierische Produkte
Jetzt leuchten sie wieder überall: die bemalten und gefärbten Ostereier. Doch woher kommt eigentlich dieser Brauch? Und warum ist der Lieferant der bunten Geschenke ausgerechnet ein Hase? Wir klären auf und geben Tipps zum Eierfärben mit Farben aus der Natur. Mehr →
Welche Milch ist aus Tierschutz- und Naturschutzsicht eigentlich empfehlenswert? Und was bedeuten die unterschiedlichen Label auf der Milch-Verpackung? Der NABU gibt einen Überblick. Mehr →
In den letzten 50 Jahren hat sich die globale Fleischproduktion gut vervierfacht: gut 360 Millionen Tonnen im Jahr 2022 – Tendenz steigend. Die Folgen reichen von Klimawandel über Artensterben bis hin zu Hunger und Wasserknappheit. Mehr →
Tiergerechte Haltung ist den Deutschen wichtig. Dennoch dominiert Massentierhaltung den Fleischmarkt. Bio-Fleisch - vor allem der Bio-Anbauverbände - garantiert bessere Umwelt- und Tierhaltungsstandards. Ganz wichtig: Tierische Produkte nur in Maßen genießen. Mehr →